Wie Communities bei Kleinanzeigen funktionieren. Session Rückblick

Für unsere 2. Session haben wir Fabian Schwarz eingeladen. Er ist Agile Coach bei Kleinanzeigen und hat uns einen spannenden Einblick in die Art und Weise wie dort Communities genutzt werden. Vielen Dank an Fabian und an alle Teilnehmenden für die erkenntnisreiche Stunde. Hier haben wir unsere Highlights zusammengefasst.
Bis zu 20% Arbeitszeit für Community-Arbeit
Bei Kleinanzeigen arbeiten Mitarbeitende nur 80% ihrer Zeit an der direkten Wertschöpfung. Die anderen 20% sind Slacktime - Zeit für Communities, individuelles Lernen, Experimente und Selbstorganisation. Was zunächst wie ein teurer Luxus klingt (den sich Kleinanzeigen auch durch seine Marktposition erlauben kann), entstand aus einer pragmatischen Frage:
"Wie können wir agil auf Markttrends reagieren, wenn alle immer zu 100% ausgelastet sind?"
Der Schlüssel war der Vertrauensvorschuss. Keine Vorab-KPIs, keine Erfolgsdefinitionen, nur die Abmachung für ein Experiment: "Wir schauen nach ein, zwei Jahren, ob etwas Sinnvolles entstanden ist."
Das Ergebnis: Communities wie der Culture Club entwickelten eigenständig Quartalsumfragen zu Unternehmenswerten, die das Management heute strategisch nutzt. Ein Experiment das sich also beweist.
Drei Typen, drei Welten
Kleinanzeigen macht eine klare Unterscheidung, in welcher Art von Gruppen welche Arbeit geschieht:
- Teams arbeiten funktionsübergreifend an konkreten Produkten. Das Team rund um die Kleinanzeigen-Suche vereint Backend-Entwickler:innen, iOS-Expert:innen und Produktmanager:innen, um dafür zu sorgen, dass "Pumpball Abdeckung" nicht "Fußball" als Ergebnis zeigt. Hier geht es um direkte Wertschöpfung.
- Communities of Practice sind Führungskraft-gesteuerte Treffen von Menschen derselben Funktion. Alle Android-Entwickler:innen besprechen, ob Radio-Button oder Bottom-Sheet besser ist – damit ähnliche Features nicht in jedem Team anders aussehen. Das passiert automatisch ab etwa 5 Personen derselben Rolle.
- Gilden, Clubs & Factories sind freiwillige, selbstorganisierte Interessengruppen quer durch alle Funktionen und Hierarchien. Die "Facilitation Factory" bringt Menschen zusammen, die Lust auf Moderation haben. Die "Neurodiversitäts-Gilde" organisiert sich rund um gemeinsame Anliegen.
Diese Klarheit schafft Freiheit – weil jede:r weiß, wann er:sie in welcher Rolle ist und was erwartet wird. Und auch, Community ist nicht gleich Community:
„Ein Club ist ein bisschen mehr Spaß, eine Gilde ist ernster – das darf sich die Gruppe selbst aussuchen.“
Diese Begriffswahl schafft soziale Wirklichkeit. Wer sagt „Ich bin in der Architecture Guild“, sagt auch: Das hier ist ernst.
Balance zwischen Struktur und Freiraum
Communities sind nicht Hobby oder Selbstverwirklichung, sondern organisierte Arbeitsweise mit klaren Erwartungen. Bei Kleinanzeigen gibt es bei Gründung einer neuen Community ein loses Playbook: Zweck/Purpose definieren, Artefakte erstellen, Rituale und Routinen etablieren. Je reifer die Community wird, desto mehr wird von ihr erwartet: eine Mission, eine Vision, Sponsoring, aktives Auftreten in der Organisation, kontinuierliche Weiterentwicklung.
Die Arbeitsmodi sind dabei vielfältig: Forschung oder Entwicklung von kleinen Projekten, Arbeitsgruppen zu zweit oder dritt, die sich konkrete Aufgaben mitnehmen, oder – was besonders gut funktioniert – Workshop-artiges Arbeiten: An Stelle von vielen kurzen Meetings sperrt sich die Gruppe zwei Tage lang ein, geht mit Fokus ein Thema an und kommt mit Ergebnissen wieder raus.
"Freudiges Scheitern" ist erlaubt, aber auf Nachfrage sollte die Community sprachfähig sein. Wer nichts zu zeigen hat, muss das begründen.
Die Architecture Guild funktioniert anders als der Culture Club – aber beide folgen dem gleichen Grundprinzip: Community-Arbeit muss strukturiert und nachvollziehbar sein, sonst verkommt sie zur Kaffeerunde.
Sponsoring von Communities
Beim Sponsoring wird es konkret: Communities können sich eine:n Sponsor:in suchen. Das ist eine Person aus den höheren Führungsebenen, die "mit ihrem Namen dafür steht." Nicht als Kontrolleur:in, sondern als Ermöglicher:in. Wenn die Datenaufbereitungs-Gilde acht Lizenzen für 2500 Euro braucht, bringt der:die Sponsor:in das in die Entscheidungsrunden: "Ich unterstütze das, können wir das ausprobieren?"
Das Sponsor-System schafft einen einfachen Feedback-Loop nach oben und nach unten. Communities bekommen Rückendeckung bei Hindernissen, Sponsor:innen bekommen direkte Einblicke in Innovation von der Basis. Wichtig: Der:die Sponsor:in ist Unterstützer:in, nicht Chef:in. Die Community bestimmt ihre Richtung selbst.
Ohne Sponsoring sterben Communities an den ersten größeren Hürden – fehlende Tools oder Ressourcen, skeptische Führungskräfte. Mit Sponsoring haben sie eine Stimme in der Organisation.
Noch eine spannende Beobachtung: Sponsoring von Communities wird als eine Ehre aufgefasst, als Auszeichnung dafür, dass man eine Person in der Organisation ist, die Dinge bewegen kann.
Klein ist das neue Groß
Die schmerzhafteste und wertvollste Erkenntnis: "Lieber 5 verlässliche als 12 sporadische Teilnehmer:innen." Große Communities werden zäh, Meetings ineffektiv, Verbindlichkeiten werden nicht eingehalten. Die Lösung ist radikal, aber wirksam: bewusst verkleinern.
"Den Weinstock beschneiden, um dickere Trauben zu ernten" – so beschreibt es Fabian. Das Ergebnis: Meetings werden wieder produktiv, Entscheidungen werden getroffen, Projekte werden fertig.
Wichtig dabei: transparent kommunizieren. Nicht heimlich ausschließen, sondern offen sagen: "Wir arbeiten lieber mit einer kleinen, verlässlichen Gruppe." Die Mitglieder, die aus der Gruppe ausscheiden, können die Entscheidung meist sehr gut nachvollziehen – weil sie selbst die Frustration ineffektiver Großgruppen kennen.
1 Frage, die ich mir nach dieser Session stelle:
- Wie viel Struktur brauchen Communities in Organisationen tatsächlich, hier scheint es mit einem groben Rahmen sehr gut zu funktionieren...
Was bleibt bei euch hängen? Wo habt ihr Fragen? Was wollt ihr tiefer verstehen?Erzählt uns davon. Wir bleiben dran – und setzen die Serie fort.
- Verbindet euch gerne mit Fabian Schwarz auf LinkedIn
- Abonniert unseren Blog, wenn ihr mehr solcher Einblicke lesen wollt.
- Und wenn ihr Communities kennt, die wir unbedingt mal vorstellen sollten – meldet euch. Wir suchen gute Geschichten, nicht perfekte Modelle.


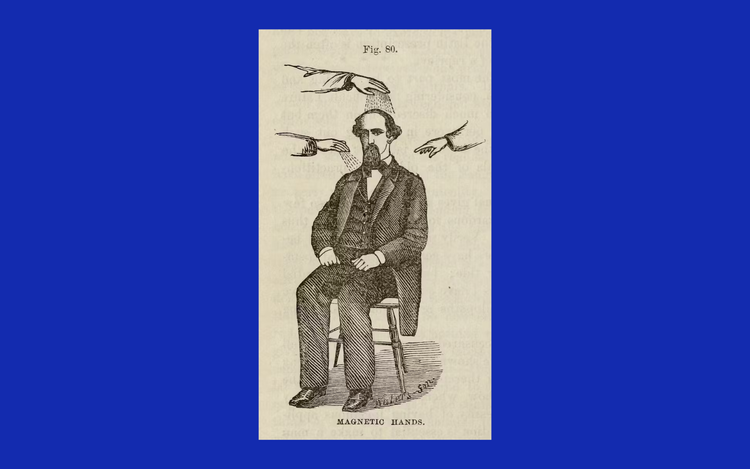



Member discussion